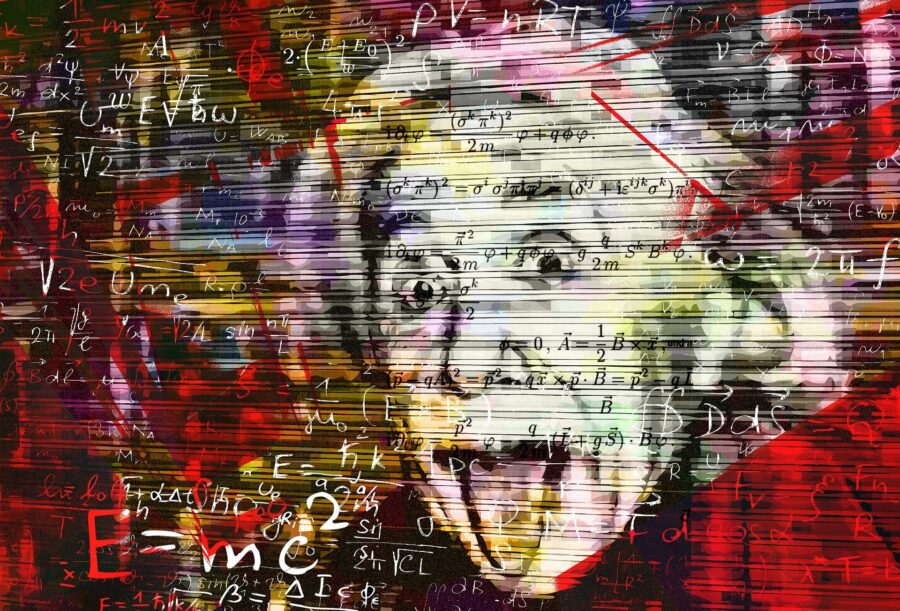Beitragsbild: pixabay_©_lizenzfrei
Motivation, Unterhaltung und im eindeutigen Wortsinn Vorbild ist mir in letzter Zeit die Lektüre der Biografie Albert Einsteins von Jürgen Neffe gewesen.
Albert Einstein war ein Phänomen – nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch als Persönlichkeit. Trotz Weltruhm blieb er bodenständig: „Jeder Besitz ist ein Stein am Bein. Es gibt nichts, auf das ich nicht jeden Augenblick verzichten könnte.“ Ein Auto besaß er nie, nahm lieber die U-Bahn oder den Bus, die Hilfe von Freunden an.
Er war ein humorvoller Skeptiker, der mit Selbstironie zum Beispiel sein Musikspiel auf der hauseigenen Geige kommentierte: „Der Dilettant hat ja sein Recht. Und spielte er auch noch so schlecht. Doch soll es andre nicht verdrießen, so muss er brav die Fenster schließen.“ Auch als Gastgeber setzte er auf Stil und Witz. In sein Gästebuch schrieb er: „Männer, Weib und Kinderlein tragt Euch in dies Büchlein ein. Aber nicht mit plumpen Worten, wie man mauschelt aller Orten. Nur mit Versen fein und zart, so nach hehrer Dichter Art. Fürchte Dich nicht und plag‘ Dich nur, du kommst schon auf die Spur.“
Einstein war ein scharfer Beobachter nicht nur physikalischer Relativitäten. Auf die Frage nach der Geschwindigkeit des Schalls sagte er trocken: „Das weiß ich nicht auswendig. Ich behalte keine Information im Kopf, die in Büchern fertig verfügbar sind.“ Über Journalisten, die alles, auch die Sprache, vereinfachen wollen, spottete er: „Ein lediglich kaschiertes Unvermögen und eine illegitime Verlegenheit, um auf eine billige Art vermeintlich zur Einsicht, Ansicht und Beschreibung der Dinge zu gelangen.“
Dem deutschen Nationalcharakter begegnete er kritisch: „Unbeherrschtheit gegenüber vermeintlich Schwächeren, Selbsthass, durch Größenwahn kompensiertes Minderwertigkeitsgefühl, Schadenfreude.“ „Drollige Gesellschaft, diese Deutschen. Ich bin ihnen eine stinkende Blume, und sie stecken mich doch immer wieder ins Knopfloch.“ Über die menschliche Natur sagte er bitter: „Menschen sind eine schlechte Erfindung.“ Und: „Die Menschen sind wie das Meer – glatt und freundlich, stürmisch und tückisch – aber eben in der Hauptsache nur Wasser.“
Einstein wusste, wie man sich distanziert – besonders von großspurigen Zeitgenossen. Ignorante, Dumme und stets Eingebildete, nicht Lebens Ausgebildete überging er „mit eisigem Schweigen“. Über Thomas Mann urteilte er spitz: „Des Dichters Oberlehrerart geht so weit, dass ich ständig fürchten muss, er werde mir gleich die Relativitätstheorie erklären.“ Auch als Professor blieb er unkonventionell, nicht schulmeisterlich, sondern universitär: „Herr Professor, das sind ja genau dieselben Fragen wie im letzten Jahr.“ – „Ja, aber die Antworten sind andere!“
Was die Welt laut Einstein wirklich regiert? „Dummheit, Furcht und Habgier.“ Bürokratie nannte er eine „Tintenscheißerei“, die „angesichts der Länge der bürokratischen Wege und der Kürze des menschlichen Lebens“ schlicht absurd sei. Zu seinem öffentlichen Bild meinte er einmal: „Die Herren spekulieren mit mir wie mit einem prämierten Legehuhn; aber ich weiß nicht, ob ich noch Eier legen kann.“ Privat, da konnte er auch „menschlich allzu unmenschlich unterwegs“ sein: Beispielsweise manches zur Nachkommenschaft bestimmte Ei Albert auch „seitwärts legte“.
Einstein war Physiker und Philosoph: „Lichtteilchen“, sagte er, „leben für immer in ihrem Augenblick.“ Nach der eigenen Theorie ist diese Aussage folgerichtig in praktischer Hinsicht, da mit der Geschwindigkeit, der Lichtgeschwindigkeit, Licht zeitlose und ewige Eigenschaften erhält. Die „Elemente“ Licht, Wasser und Luft. Der „Äther“ im Raum auch deshalb überflüssig, da, wenn alles aus dem Raum genommen wird, der Raum sowie die Zeit ebenfalls mit den Dingen verschwinden. Über das Lebenselixier Wasser – wieder ganz Mensch: „Schließlich ist selbst Wasser ein Gift, wenn man drin ersäuft.“
Sein Verhältnis zur Religion war komplex. Er bezeichnete sich als „tiefreligiösen Ungläubigen“ und schrieb: „Ein Glaube ist die stärkste und edelste Triebfeder wissenschaftlicher Forschung: Wissenschaft ohne Religion ist lahm, Religion ohne Wissenschaft blind.“ Er glaubte nicht an einen Gott im menschlichen Sinne: „Einen Gott, der (…) belohnt oder bestraft, (…) kann ich mir nicht einbilden. Dieses Gottesbild ist ein Versuch, das Moralgesetz auf Furcht zu gründen.“ Seine Form von Religiosität: „Das Erlebnis des Geheimnisvollen, der Manifestationen tiefster Vernunft und leuchtender Schönheit (…) macht wahre Religiosität aus.“
Auch politische Botschaften verpackte er mit Witz: „Die ausgestreckte Zunge gibt meine politischen Anschauungen wieder.“ Und über die Feindschaft mancher Zeitgenossen meinte er lakonisch: Es sei „wahrscheinlich leichter, Kain und Abel zu versöhnen.“ Einstein war – trotz oder wegen seiner Brillanz – ein Mensch mit Haltung, Witz und Widerstandskraft. Oder wie er selbst sagte: „Es gibt niemanden, der mich verletzen kann, es fließt an mir ab wie Wasser am Krokodil.“
Auch ihm, dieser einzigartigen Lichtgestalt, schlug endzeitlich die Stunde: Biograph Jürgen Neffe: „Einstein sagt, er wolle ‚mit Grazie‘ abtreten. ‘Ich möchte gehen, wann ich möchte. Es ist geschmacklos, das Leben künstlich zu verlängern.‘ Für ihn steht schon lange fest: ‚Man kann auch ohne Hilfe eines Arztes sterben.‘ Als ihn am Vorabend seines Todes sein Freund Gustav Bucky verlässt, fragt er ihn, warum er denn schon gehe. ‚Du sollst schlafen‘, antwortet dieser. Erwiderung Einstein: ‚Daran würde mich auch deine Gegenwart nicht stören.‘… Er soll (am Todestag) auch noch gesagt haben: ‚Ich habe meine Sache hier getan!‘“
Ein allerletztes Zitat: „Abschied von dieser sonderbaren Welt: Für einen gläubigen Physiker hat die Scheidung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nur die Bedeutung einer wenn auch hartnäckigen Illusion.“
Aussage der Lichtgestalt Æ !